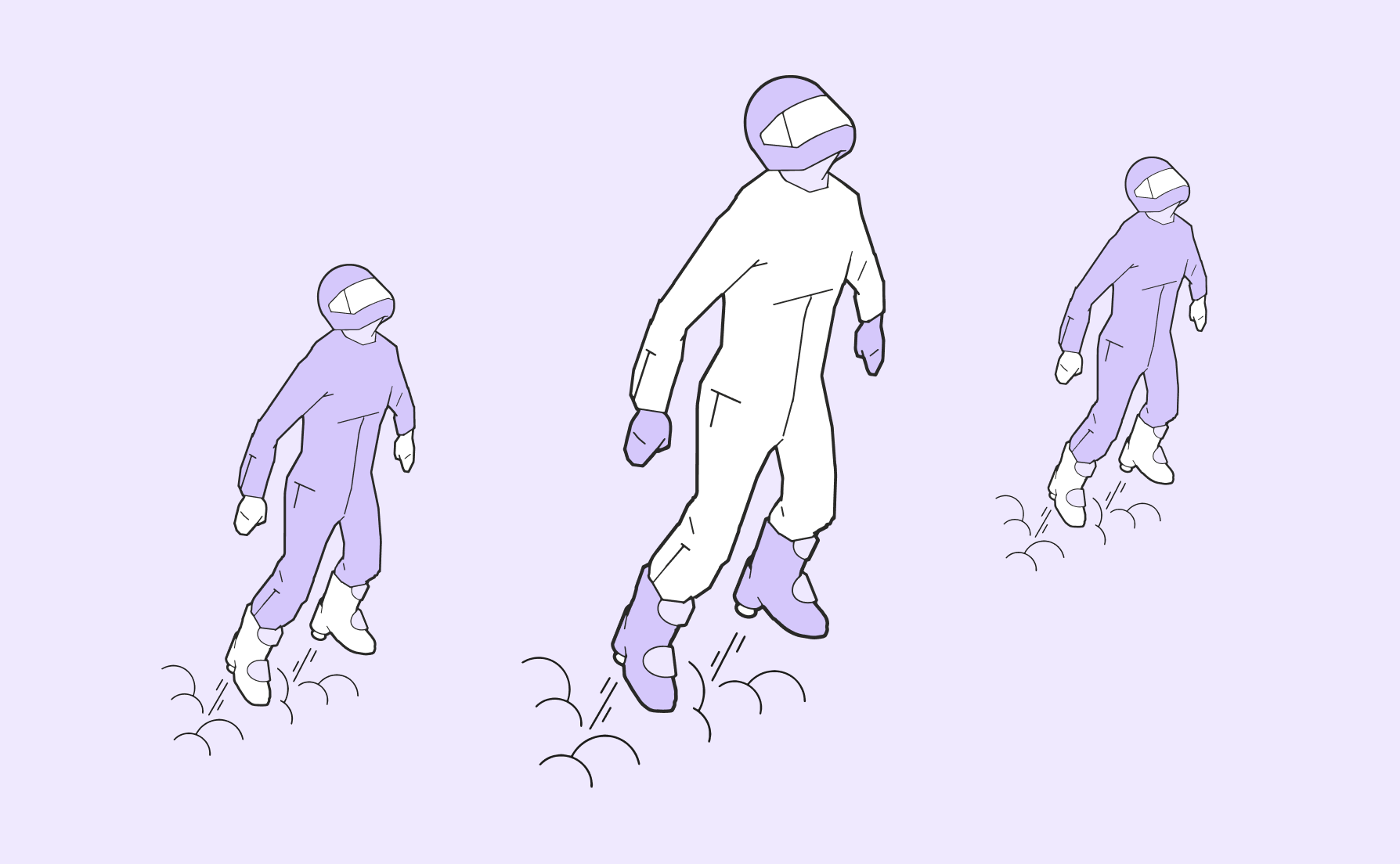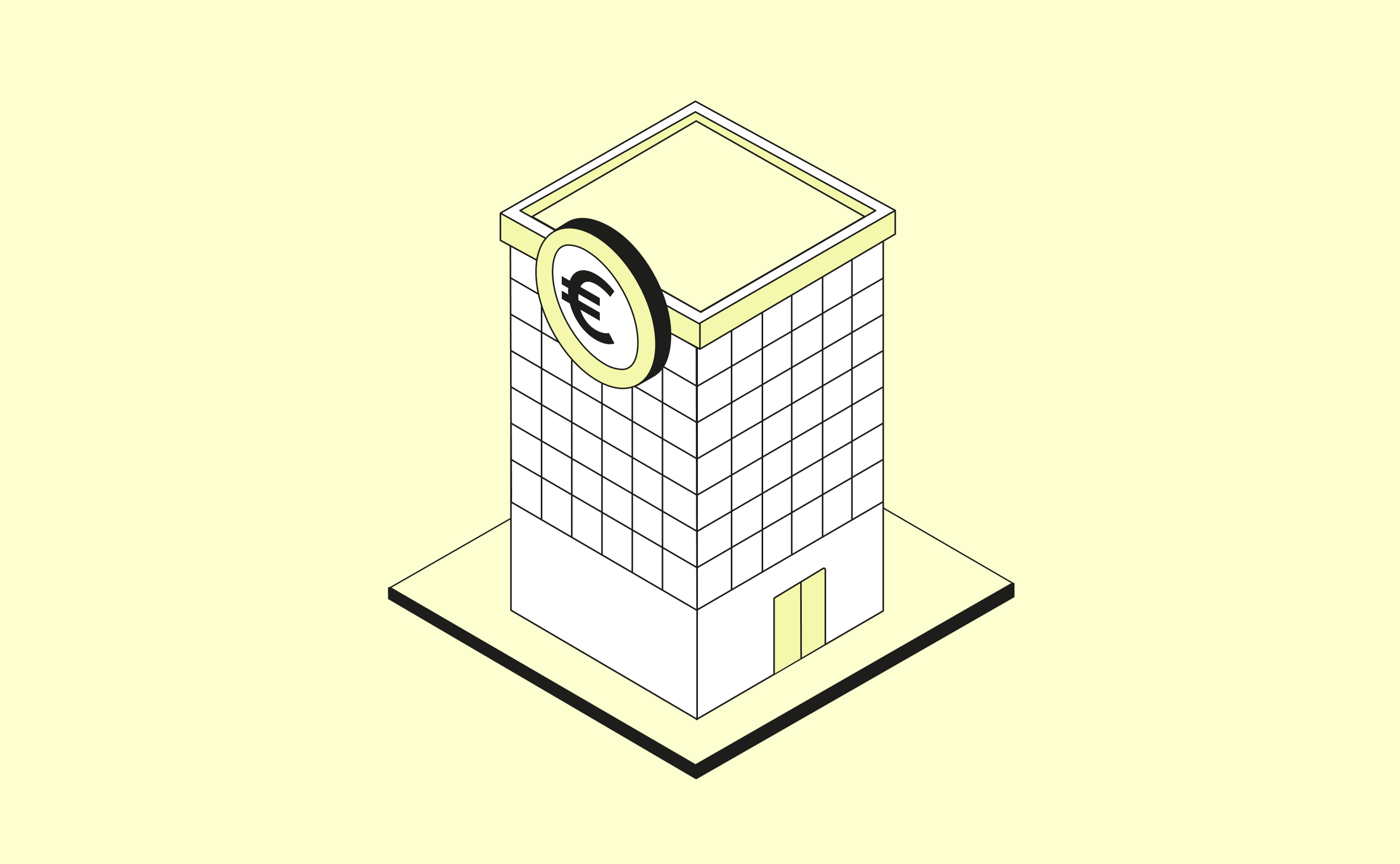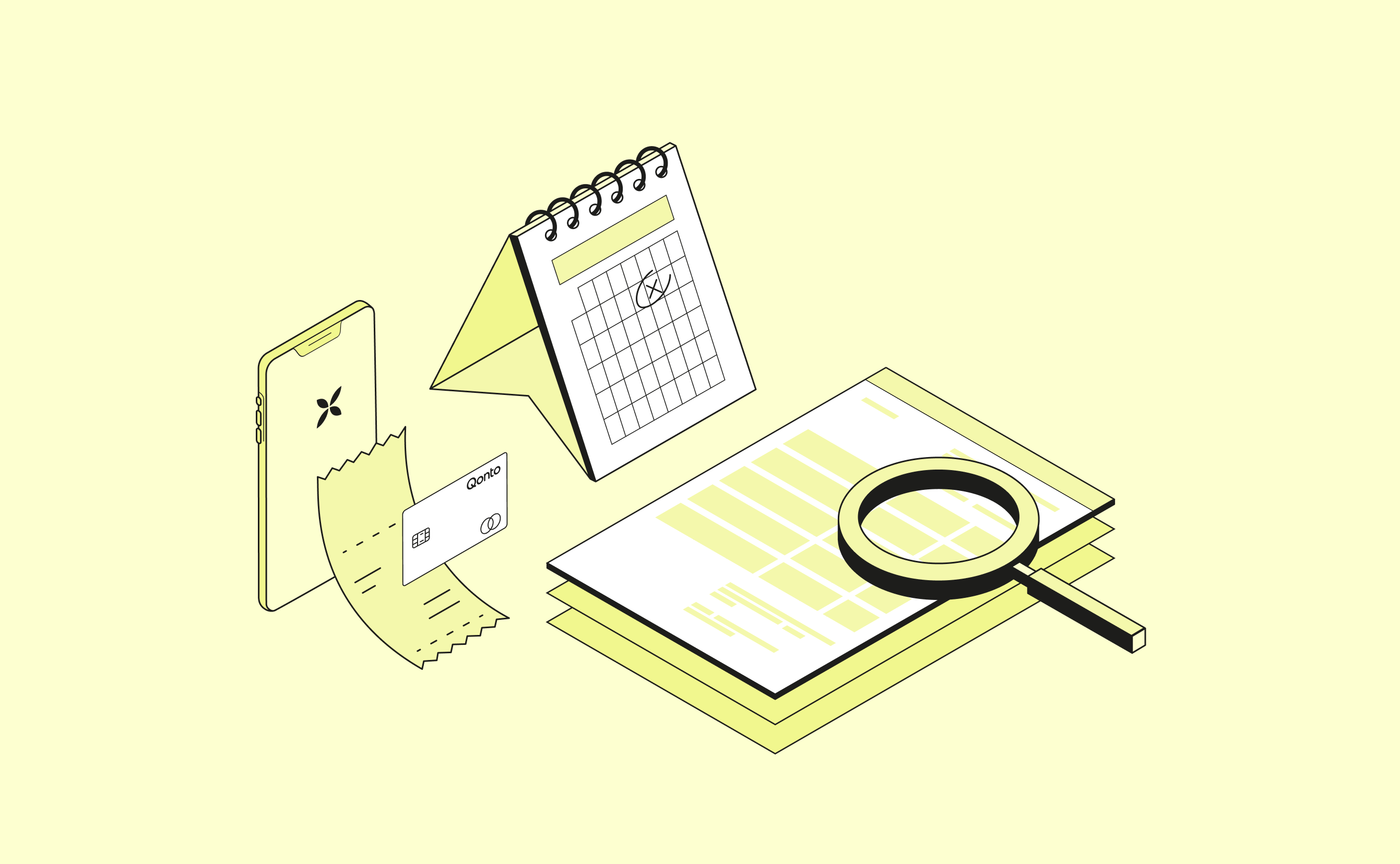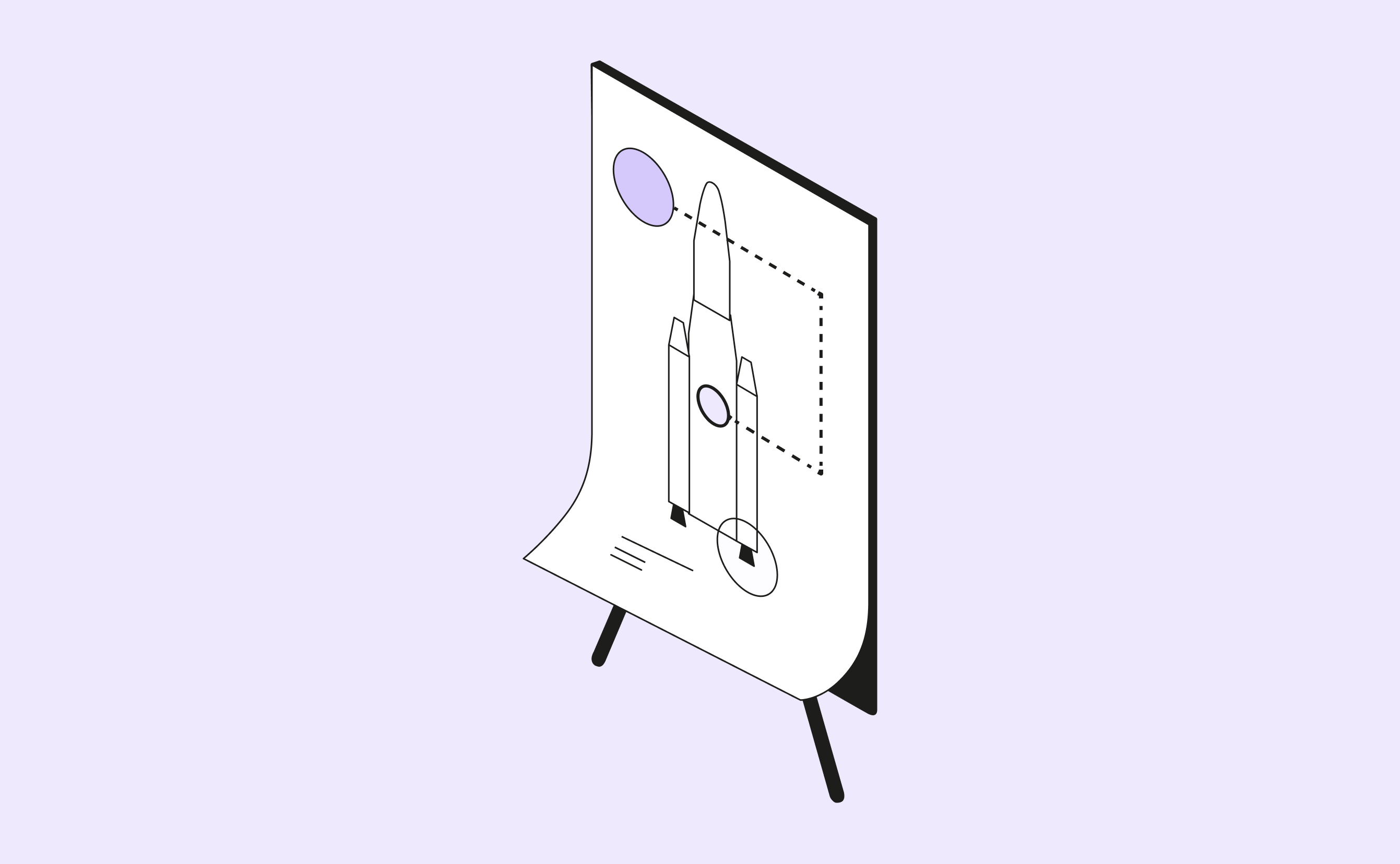Irren ist menschlich – und im Geschäftsalltag gibt es dafür viele Gelegenheiten. Studien gehen davon aus, dass wir täglich bis zu 20.000 Entscheidungen treffen. Viele Denkprozesse laufen dabei automatisiert ab.
So können wir die Flut an Informationen, die ständig auf uns einwirken, schneller steuern und bewältigen. Das ist evolutionsbiologisch effizient und nützlich, hat aber auch Nachteile. Denn fast immer denken wir deshalb nicht so rational und klar, wie es für viele Situationen von Vorteil wäre. Subjektive Wahrnehmungen, Denkmuster, Erfahrungen und Einstellungen beeinflussen unbewusst unsere Entscheidungen.
Für diese Denk- und Wahrnehmungsfehler hat der US-amerikanische Psychologe und Wirtschaftswissenschaftler Daniel Kahneman in den 1970er Jahren den Begriff “Cognitive Bias”, auf Deutsch: "kognitive Verzerrung geprägt". Aber wie können wir diese Denkfehler überwinden, um im Geschäftsalltag gute Entscheidungen zu treffen? Ein erster wichtiger Schritt besteht darin, sie zu erkennen.