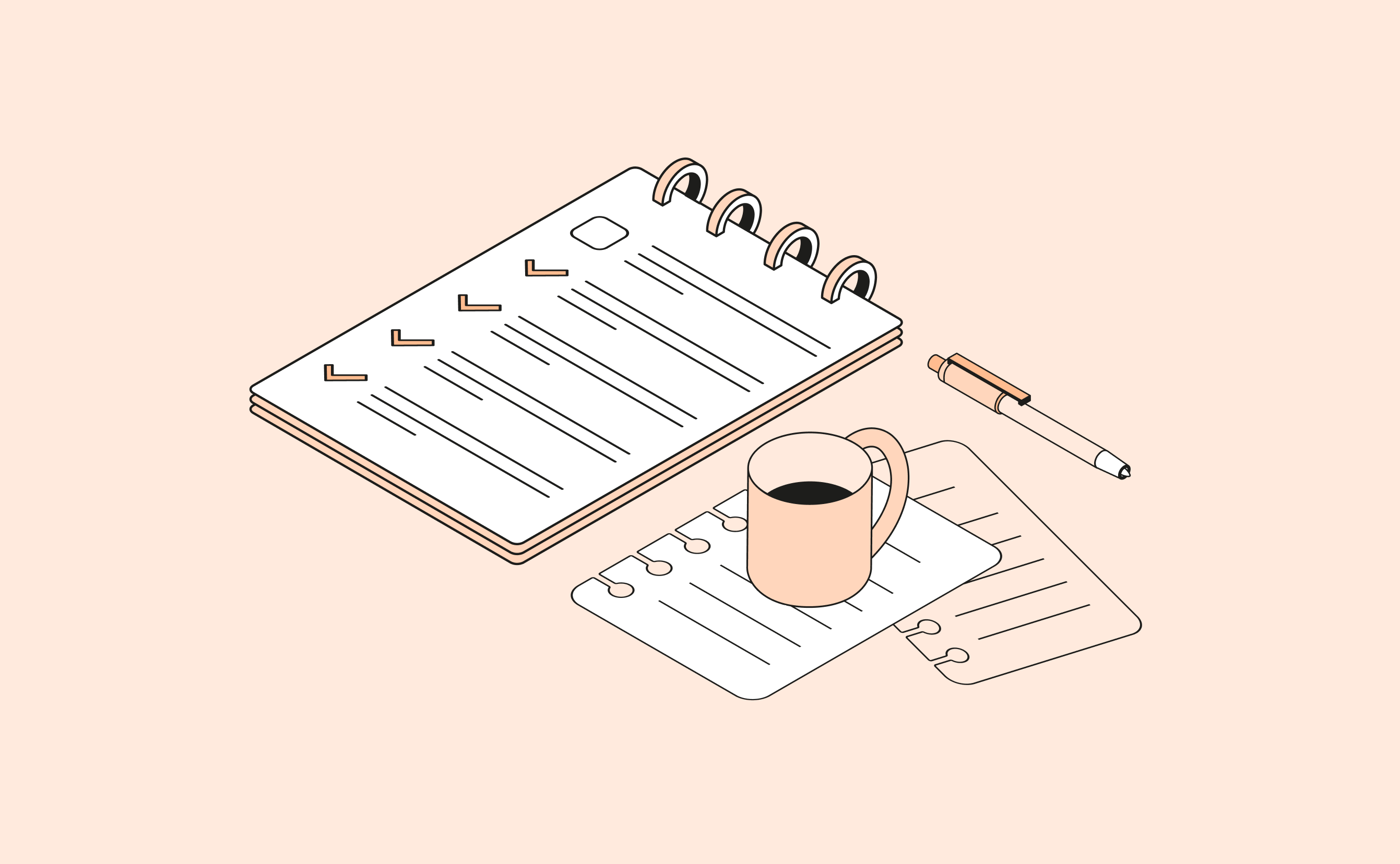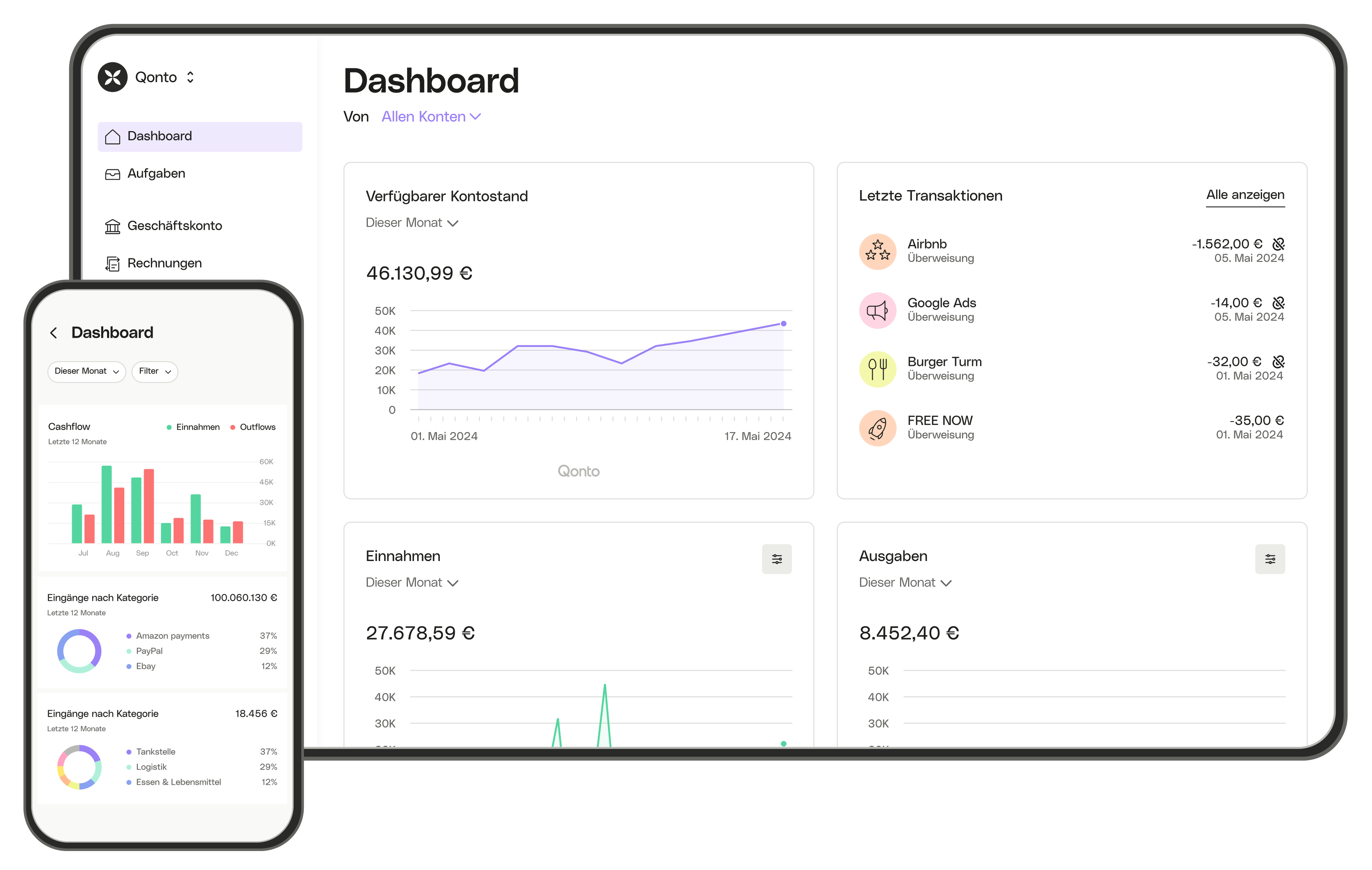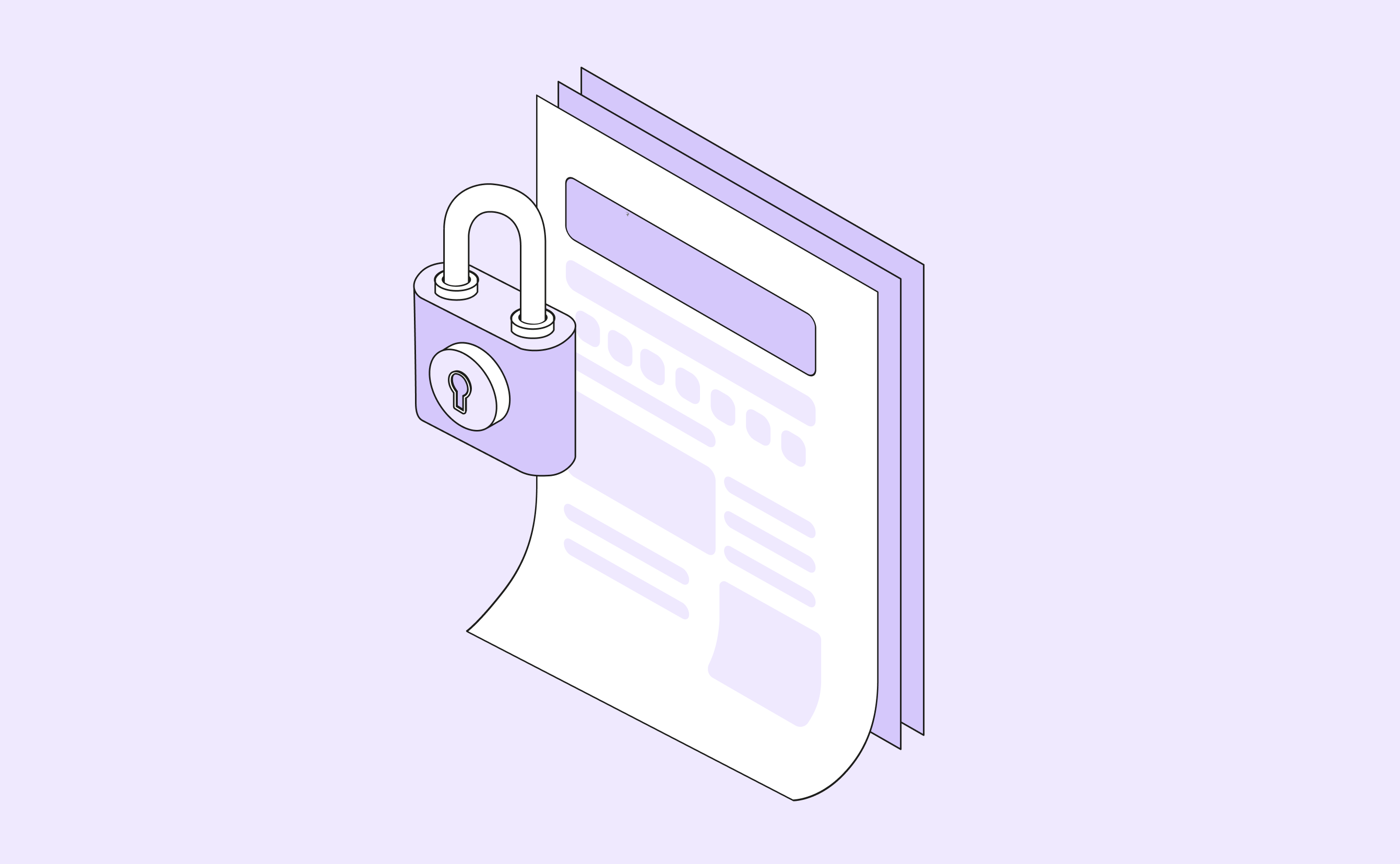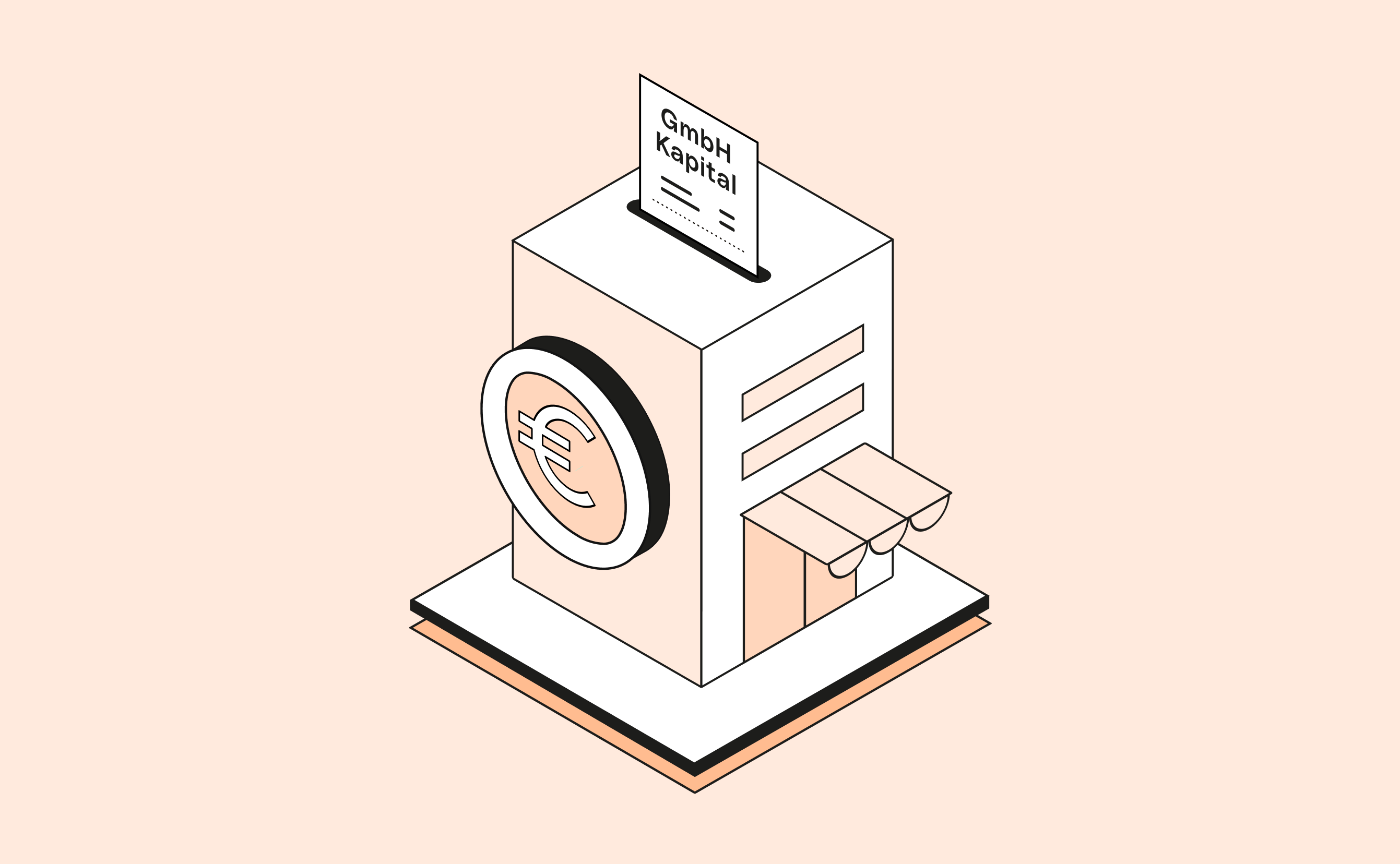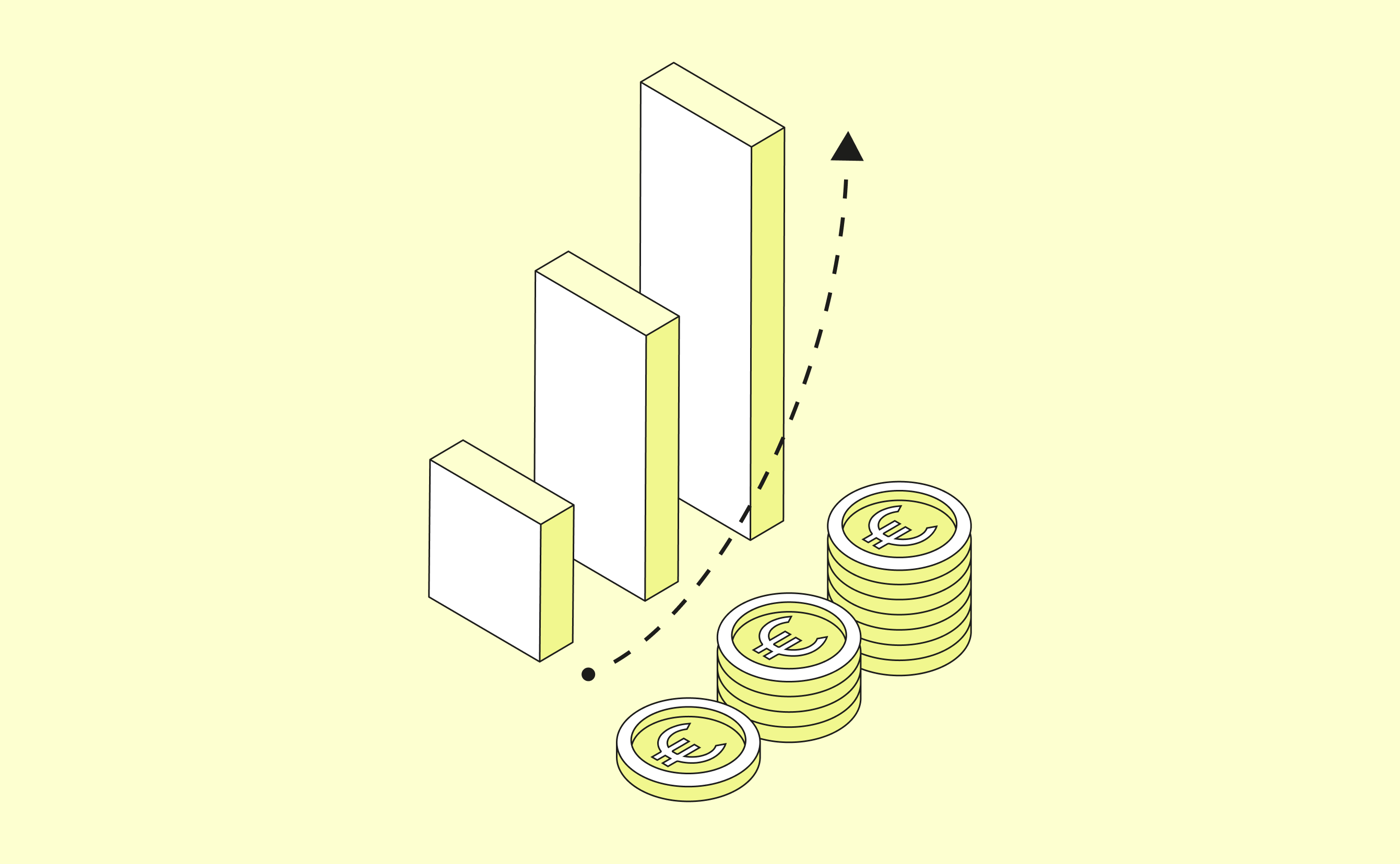Einzelunternehmen werden oft von Soloselbstständigen gegründet. Sie besitzen es komplett und haften vollumfänglich, auch mit ihrem Privatvermögen. Die Gründung ist kostengünstig und kann ohne oder mit beliebigem Stammkapital erfolgen.
Personengesellschaften benötigen mindestens zwei Beteiligte. Alle haften persönlich und uneingeschränkt mit ihrem Privatvermögen. Eine Kapitaleinlage ist möglich, aber nicht zwingend.
Kapitalgesellschaften fokussieren auf das eingebrachte Kapital. Sie trennen strikt Gesellschaft und Gesellschafter:innen. Mindestens zwei Beteiligte sind erforderlich. Eine Kapitaleinlage zwischen 1 und 50.000 € ist Pflicht. Die Haftung erfolgt über das Gesellschaftsvermögen.
Die Entscheidung für eine Rechtsform hat persönliche, finanzielle, steuerliche und rechtliche Folgen. Sie sollte daher gut überlegt sein – nicht nur im Hinblick auf die Gründung, sondern auch mit Blick in die Zukunft. Eine Unternehmensform, die zum Start Ihrer Selbstständigkeit genau richtig war, kann sich später aufgrund von Veränderungen im Unternehmen als nachteilig erweisen.